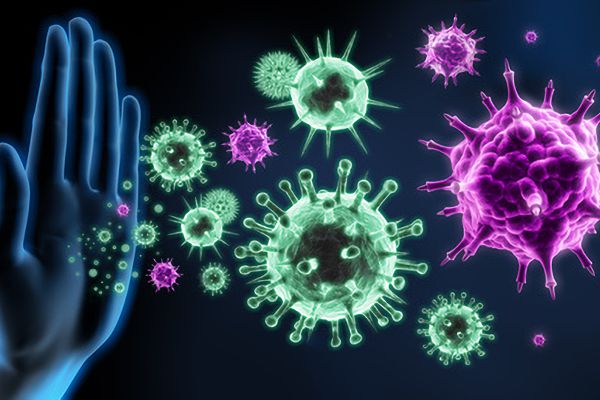Psychischer Stress kann die Wundheilung um 45 % verlangsamen. Grund dafür ist unter anderem ein durch Cortisol (Stresshormon) verursachter Mangel an Sauerstoff im Wundmilieu, der den reparierenden Zellbildungsprozess des Immunsystems verhindert. Das ist in einfachen Worten das Ergebnis einer Studie des UIC College of Dentistry von 2005. Schon vier Jahre vorher hatte die Ohio State University nachgewiesen, dass bei der Wundheilung unter Stresshormonen die Gefahr einer Infektion zum Beispiel mit Staphylokokken um ein Dreifaches erhöht ist. Wer will angesichts dieser seither immer wieder wissenschaftlich untermauerten Ergebnisse heute noch die bedeutende Rolle der Stressreduktion in der Medizin in Frage stellen?
In einer Projektarbeit für den Verein Wundmanagement Tirol von 2012 hat Aurelija Weiger mit einer Vielzahl an Verweisen auf Studien zur Wundheilung das Thema Psyche, Körper und gesellschaftliche Verantwortung erstaunlich umfangreich und nachvollziehbar auf den Punkt gebracht. Dabei ging sie zunächst auf die generellen Prozesse der Wundheilung ein, die im Groben aus drei Phasen bestehen:
- In der Exsudationsphase findet durch Austritt von Wundsekret und zellulare Prozesse eine Wundreinigung und der Abtransport überflüssiger Zelltrümmer statt.
- In der Granulationsphase entstehen neues Bindegewebe, Haargefäße und Kollagen.
- In der Regenerationsphase deckt der Körper den regenerierten Wundbereich mit Epithelzellen, also dem ab, was wir in gesundem Zustand als Hautoberfläche empfinden.
Für eine gute Wundheilung braucht es zusätzlich ein sauerstoffreiches und feuchtes Milieu.
Bei Stress werden die Hormone Cortisol, Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Sie führen unter anderem zu einem Sauerstoffmangel im Wundmilieu und blockieren zellulare und sogar genetische Prozesse, die die Phasen der Wundheilung nacheinander in Gang setzen sollten.

Soviel zur reinen Theorie. Überträgt man diese Erkenntnisse in die Praxis, ergibt sich eine spannende Frage: Wie wirkt sich Stress auf Patienten, Therapeuten, Pflegebedürftige und deren Angehörige aus und welchen zusätzlichen (auch medizinwirtschaftlichen Schaden) kann er verursachen? Aurelija Weigers Projektarbeit wirft ein Schlaglicht darauf, denn sie hat in einer selten kompakten Weise die Ergebnisse zahlreicher Studien zum Thema zusammengefasst.
- Pflegende Angehörige von Demenzkranken (geprägt durch zunehmende Desorientierung und auch Aggression der pflegebedürftigen Familienmitglieder) wiesen nach einer Stanzbiopsie eine um 24 Prozent verlängerte Zeit der Wundheilung auf als die nichtpflegende Kontrollgruppe.
- Der psychische Stress des Betreuungspersonals oder der Angehörigen überträgt sich direkt auf die zu pflegenden Personen und verschlechtert auch bei ihnen die Wundheilung (Dekubitus).
- Der Effekt (Stress = Verlangsamung der Wundheilung) lässt sich auch auf junge Menschen übertragen. Eine Schülergruppe wies vor schweren Prüfungen nach einer Stanzbiopsie 40 % langsamere Wundheilung auf als die Kontrollgruppe nach den Sommerferien.
Die Sommerferien sind der untrügliche Hinweise darauf, dass aktive Stressreduktion die Wundheilung fördern kann.
- Werden Kandidaten für eine Operation mental positiv vorbereitet, gibt es signifikant weniger postoperative Komplikationen.
- Bewegung in Form von leichtem Cardiotraining oder sogar das Niederschreiben von Emotionen verbessern den Wundheilungsprozess.
- Die Ausschüttung des „Kuschelhormons“ Oxytocin fördert die funktionellen und zellulären Prozesse der Wundheilung. Oxytocin wird durch sozialen Kontakt wie Berührungen, freundschaftlichen Umgang, gemeinschaftliche Aktivitäten – oder schlicht Zuwendung gebildet.
Was schließt Aurelija Weiger aus all diesen Erkenntnissen speziell für die Pflege und den zwischenmenschlichen Umgang? – Statt in die theoretische Dokumentation von „Gesprächsminuten“ und mechanischen Wundversorgungseinheiten sollte man Zeit in menschliche Zuwendung investieren, weil die daraus resultierende Oxytocinausschüttung und Cortisolreduktion so manchen Dekubitus lindern oder sogar verhindern könnte. Das brächte Einsparungspotenziale im Medikamenten- und Pflegemitteleinsatz. Denn wie zitiert Weiger Saint-Exupérys Kleinen Prinzen so schön: Als ihm eine Wunderpille angeboten wird, die den Durst stillt und dem Menschen, der sich das Wassertrinken spart, in der Woche 53 Extra-Minuten bringt, meint der Kleine Prinz: „Hätte ich 53 Minuten übrig, würde ich ganz gemächlich zu einem Brunnen laufen …“
Im nächsten Blog möchte ich über positiven und negativen Stress sprechen und darüber, was die Stressstrategie von Jon Kabat-Zinn so außergewöhnlich macht.
Ihr Hubert Brüderlein